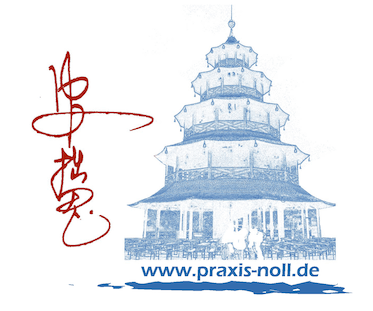Psycho-Somatik
"Wenn die Seele leidet, wird der Körper krank"
von Susanne Krell
Mens sana in corpore sano - Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper" - dieses Sprichwort der alten Römer beschreibt
die enge Verzahnung des körperlichen mit dem seelischen Zustand eines Menschen. Einerseits kann ein gesunder Geist nur in
einer gesunden "Behausung" existieren, aber andererseits ist der Geist selbst mitverantwortlich dafür, daß diese Behausung
gesund ist und bleibt.Die Wissenschaftler des 17. Jahrhunderts - allen voran Descartes - waren da allerdings ganz anderer Ansicht. Sie glaubten,
daß Seele und Körper eines Menschen streng voneinander zu trennen seien und keinen Einfluß aufeinander nähmen. Diese
Ansicht hielt sich - mehr oder minder stark - bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als allmählich wieder ein Umdenken stattfand.
Heute ist man der Ansicht, daß man Körper und Seele nicht trennen kann, weil der Körper stets auf seelische Vorgänge
reagiert und umgekehrt. Dies läßt sich an einfachen Beispielen aus dem alltäglichen Leben belegen:
Wer zum Beispiel starke Kopfschmerzen hat, leidet auch psychisch darunter - der körperliche Schmerz verursacht schlechte
Stimmung, Gereiztheit, etc.
Andererseits kennt wohl jeder aus eigener Erfahrung, daß zum Beispiel der Streß "auf den Magen schlägt" oder, daß wir bei
großer Trauer oder Freude weinen, also eine körperliche Reaktion zeigen, die alleine durch seelische Ursachen bedingt ist.Allgemein verwendet man hierfür den Begriff des "funktionellen Syndroms", was besagt, daß
1. das Beschwerdebild das Resultat von Funktionsstörungen sein soll
2. diese Funktionsstörungen nicht auf organischen Veränderungen beruhen
3. sie durch seelische, vor allem emotionale Vorgänge ausgelöst werden
4. sie die Funktion eines Bewältigungsversuches ungelöster Konflikte haben
Psychische Ursachen innerer Erkrankungen
Im Folgenden sollen einige, teilweise recht schwerwiegende innere Krankheiten beschrieben werden, für deren Entstehung und
Aufrechterhaltung psychologische Faktoren eine wesentliche Rolle spielen.
l. Essentielle Hypertonie
Nach Empfehlungen der WHO spricht man von einer Hypertonie, wenn bei mehrfachen Messungen über längere Zeit die
systolischen Blutdruckwerte 160 und/oder die diastolischen 95 mmHg überschreiten. Bei einem Teil der Patienten (ca. 10 %)
kann der Bluthochdruck als Folge von Grundkrankheiten wie Nierentzündung, Stoffwechselstörungen oder Arteriosklerose
erklärt werden. Man spricht dann von sekundärer Hypertonie.
Die restlichen 90 % der Hochdruckfälle lassen sich nicht auf eine Grundkrankheit zurückführen, wobei es sich hier dann um
eine primäre/essentielle Hypertonie handelt.
Man schätzt, daß in Deutschland jährlich dreimal mehr Menschen an Erkrankungen des Kreislaufsystems sterben als an Krebs
und auch in den USA steht die essentielle Hypertonie mit den von ihr verursachten Komplikationen an erster Stelle der
Todesursachen.
Bei der Entstehung einer Hypertonie sind meist vielfältige Faktoren beteiligt: Übergewicht, extrem kochsalzreiche Ernährung,
altersbedingter Bluthochdruck, eventuell sogar genetische Faktoren. Unbestritten sind aber auch psychologische Ursachen, auf
die hier näher eingegangen werden soll.Psychische Merkmale
Hypertoniker geben den Anschein "normaler als normal" zu sein. Bastiaans (1963) beschreibt eine sogenannte
"Fassadenstruktur":
"Nach außen erscheinen sie beherrscht, aktiv, ambitiös, perfektionistisch, gewissenhaft, zuverlässig, pflichtbewußt, genau,
ehrlich, charmant, loyal und freundlich. Hinter dieser Fassade verbirgt sich jedoch in ausgeprägtem Maße Unsicherheit,
Sensibilität, Verletzlichkeit, Abhängigkeit und Unausgeglichenheit. So gefügig und friedliebend, wie sie nach außen hin wirken,
sind sie in Wahrheit nicht. Wollen sie auch bewußt Frieden stiften (wie sie das oft zwischen Vater und Mutter tun wollten), so
sind sie auf einem weniger bewußten Niveau zu `Streit und Krieg' bereit." (aus: Uexküll, Psychosomat. Medizin)Treten Konflikte auf, schirmen sich Hypertoniker dagegen ab, indem sie unangenehme Empfindungen praktisch ausfiltern, diese
Gefühle unterdrücken und sich als angepaßt, konfliktvermeidend und "nett" zeigen. Es fällt auch auf, daß der Bluthochdruck
familiär gehäuft auftritt, was als "psychologische Vererbung" gedeutet werden kann. Unter diesem Begriff versteht man die
Tatsache, daß in der Familie von Hypertonikern bestimmte psychische Haltungen geprägt werden, die zum Erwerb einer
Hypertonie disponiert und, daß das Verhalten eines hypertonischen Familienmitglieds die gesamte Interaktion innerhalb der
Familie beeinflußt. So zeigten zum Beispiel in einer Studie Familien mit einem hypertonen Vater deutlich mehr Ablehnung und
negative Interaktion als die Kontrollgruppe. Dies äußerte sich sowohl verbal durch Kritik, Verneinungen und Unterbrechungen,
als auch non-verbal durch fehlenden Blickkontakt, "Kopf-zur-Seite-Drehen" und "Grimassieren". Dieses Verhalten legten aber
nicht nur die Väter, sondern auch die normotonen Mütter und Kinder an den Tag.Hypertoniker sind anscheinend in geringerem Maße fähig, auftretende Aggressionen auszuleben. Man nimmt an, daß diese
chronisch gehemmten aggressiven Antriebe ein wesentliches psychodynamisches Moment bei der Entstehung einer
Bluthochdruckerkrankung darstellt. Entwickeln die Patienten nämlich plötzlich neurotische Symptome zur Abwehr der
aggressiven Impulse, sinkt auch der Blutdruck, oft beinahe bis auf Normwerte.Eine weitere Komponente der Hypertonieentwicklung beschreibt die sogenannte "Streßhypothese". Hier spielen psychosoziale
Belastungen für den Patienten eine große Rolle. Dabei kommt es nicht so sehr auf die Art des Stressors an, sondern darauf,
wie die Betroffenen die Situation bewältigen. Es zeigte sich in verschiedenen Studien, daß Hypertoniker auf Streß wesentlich
heftiger reagieren und schlechter damit umgehen können als Personen mit normalen Blutdruckwerten. Die Schwelle für die
Auslösung einer Alarmreaktion des Organismus bei psychischem Streß (Adrenalin - und Corticosteroidausschüttung) liegt bei
einem Hypertoniker bedeutend niedriger und der Rückgang zur Normalsituation ist gegenüber dem Normotoniker verzögert.
Entsprechend der vielfältigen Auslösemechanismen sollten auch bei der Therapie der essentiellen Hypertonie mehrere
Methoden gleichzeitig eingesetzt werden:
Die grundlegenden Maßnahmen bestehen natürlich in einer Einschränkung der Kochsalzzufuhr, Gewichtsabnahme bei adipösen
Patienten und ausreichender körperlicher Betätigung. Meist kann auch der Einsatz von Medikamenten nicht völlig umgangen
werden, um zum Beispiel mit Diuretika über vermehrte Ausschwemmung von Kochsalz und Wasser wenigstens initial eine
Blutdrucksenkung zu erreichen.Hinsichtlich der oben genannten psychologischen Faktoren darf aber auch die Effizienz verhaltenstherapeutischer Interventionen
nicht vernachlässigt werden. Besonders erfolgreich sind hierbei verschiedene Entspannungstechniken, wie Autogenes Training,
progressive Muskelentspannung nach Jacobson oder diverse Meditationspraktiken. Auch mir Hilfe von Yoga wurden bereits
gute Ergebnisse erzielt. Ein weiterer Ansatz ist eine, speziell für Hypertoniker entwickelte Biofeedbacktherapie, bei der die
Blutdruckwerte des Patienten laufend gemessen werden und ein Absinken der Werte angezeigt wird, eventuell noch durch
verbales Lob oder anderweitig verstärkt.
2. Erkrankungen des Herzens
Koronare Herzkrankheit:
Von Koronarinsuffizienz spricht man, wenn dem Herzmuskel weniger Sauerstoff zugeführt wird, als er zur vollen Deckung
seines Bedarfs benötigt. Bei der koronaren Herzkrankheit (KHK) besteht diese Insuffizienz aufgrund von Verengungen der
Herzkranzarterien und manifestiert sich oft durch die Symptome der Angina pectoris. Die Folgen sind häufig Herzinfarkt,
Rhythmusstörungen und Herzinsuffizienz.Wenn auch nicht obligat, so ist die Angina pectoris doch das häufigste Symptom der KHK. Dabei treten - zunächst nur unter
körperlicher und psychischer Belastung, später auch in Ruhe - drückende, hinter dem Brustbein lokalisierte Schmerzen auf. Sie
können über die linke Brust und den linken Arm ziehen oder auch im Rücken- oder Halsbereich lokalisiert sein, und sind häufig
mit Angstzuständen verbunden. In den ersten Stadien der Krankheit verschwinden die Schmerzen noch relativ schnell nach der
Einnahme von Nitropräparaten oder mit dem Ende der ursprünglichen Belastung.Unter Herzinfarkt versteht man einen akuten Untergang von Herzmuskelgewebe, meist bedingt durch den Verschluß einer
Koronararterie durch ein Blutgerinnsel. Es besteht nun die akute Gefahr des Todes durch Herzmuskelversagen oder es bilden
sich die Symptome des Herzinfarkts aus:
schwere Angina pectoris, Atemnot als Zeichen der Leistungseinschränkung der linken Kammer und Schocksymptome, wie
Blutdruckabfall und Anstieg der Pulsfrequenz.Eine Reihe von Infarkten verläuft aber auch ohne die typischen Symptome und wird häufig erst in späteren Untersuchungen
anhand von EKG-Veränderungen diagnostiziert.Etwa 35 % der Betroffenen sterben an den Folgen des Infarkts, beim Rest der Patienten heilt der Schaden unter
Narbenbildung.Die organischen Risikofaktoren der KHK, wie hoher LDL-Cholesterinspiegel, Rauchen, Bluthochdruck, Übergewicht und
mangelnde körperliche Aktivität sind allgemein bekannt. Doch wie bei der essentiellen Hypertonie spielen auch bei den KHK
psychosoziale und psychologische Faktoren eine entscheidende Rolle.Im Falle der koronaren Herzkrankheiten faßt man diese Faktoren unter dem Begriff der "Risikopersönlichkeit" zusammen.
Ende der fünfziger Jahre führten Friedman und Rosenman für besonders gefährdete Patienten der Begriff des "Verhaltenstyp A"
ein.Kennzeichnend für diese Personen ist:
- ein intensives, anhaltendes Streben nach selbstgesetzten Zielen, die aber meist zu hoch gesteckt sind
- ausgeprägtes Wettbewerbsverhalten
- ständiger Wunsch nach Anerkennung
- großes Engagement mit selbstauferlegtem Termin- und Zeitdruck
- Außergewöhnliche geistige und körperliche Wachheit
- Neigung zu schnellem Sprechen, Abschneiden des Wortes und Unterbrechen
- teilweise Reizbarkeit, Feindseligkeit und ZynismusPersonen, die viele Elemente dieses Verhaltens zeigen werden als Typ A, die nur wenige oder keine zeigen, als Typ B
bezeichnet. Studien haben ergeben, daß die Erkrankungswahrscheinlichkeit für Typ A doppelt so hoch liegt wie für Typ B.Auffällig ist auch die Art und Weise wie Typ A Personen auf Streß, besonders, wenn dieser in Form eines Wettbewerbes
auftritt, reagieren.In einem Experiment wurde einer Typ A und einer Typ B Person ein unlösbares Puzzle vorgelegt. Als Belohnung stand eine
Flasche französischen Weins in Aussicht. Bei gleichen Ausgangswerten reagierte die Typ A Person mit deutlich höherem
Noradrenalinanstieg, was darauf schließen läßt, daß ein stärkerer sympathischer Einfluß auf das kardiovaskuläre System
besteht. Belegt wurde dies durch weitere Experimente, wo Typ A Personen zum Beispiel in einem Wissensquiz stark erhöhte
systolische Blutdruckwerte aufwiesen.Ebenfalls starke Abweichungen von den Normwerten ergaben sich, wenn sich die Versuchspersonen unfair behandelt fühlten,
während andererseits Stressoren, wie zum Beispiel der Knall eines zerplatzenden Luftballons bei Typ A und bei Typ B die
gleiche Reaktion auslösten.Im Gegensatz zu den Hypertonikern, die ja dazu tendieren, Aggressionen zu unterdrücken, zeigen Typ A Personen ihre Wut
und reagieren mit Feindseligkeit. Treffend beschrieb dieses Phänom der englische Chirurg John Hunter, der selbst an einer
koronaren Herzkrankheit litt:
"Mein Leben liegt in der Hand eines jeden Rüpels, der es darauf anlegt, mich in Wut zu bringen." Er hatte erkannt, daß in
seinem Verhalten der Auslöser seiner Angina pectoris-Schmerzen lag. Tatsächlich starb Hunter kurze Zeit später, im Jahre
1793, nach einer erhitzten Auseinandersetzung mit einem Kollegen im St. George's Hospital in London.Die Basismaßnahmen zur Therapie der KHK sind natürlich eine weitgehende Ausschaltung der Risikofaktoren Rauchen,
erhöhter Cholesterinspiegel und Hypertonie. In schweren Fällen ist sogar eine mechanische Erweiterung der Koronarien oder
eine Bypass-Operation nötig.
Psychologische Intervention findet leider oft erst nach dem Auftreten eines ersten Infarkts statt und besteht dann meist darin,
dem Patienten bei der Bearbeitung der neuen Lebenssituation zu helfen. Ein wichtiges Ziel einer therapeutischen Behandlung
sollte aber auf jeden Fall auch eine "Verhaltensänderung" weg vom Typ A Muster und den dafür spezifischen Denk- und
Handlungsweisen sein. Untersuchungen ergaben, daß der Prozentsatz der Re-infarkte auf diese Weise signifikant gesenkt
werden konnte.Herzrhythmusstörungen:
Unter Herzrhythmusstörungen versteht man sowohl Störungen der Erregungsleitung als auch der Erregungsbildung. Schlägt das
Herz zu langsam, spricht man von Bradykardie, schlägt es zu schnell, von Tachykardie.Bei Bradykardien können aufgrund einer mangelnden Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff Ohnmachten auftreten, dies vor
allem bei älteren Patienten.Eine weitere Form der Störungen sind die sogenannten Extrasystolen, außerhalb des Herzrhythmus einfallende Schläge, die
zuweilen als Herzstolpern auffallen. Vereinzelt kommen sie auch beim Herzgesunden vor, treten sie aber gehäuft auf, können sie
Kammerflimmern auslösen.In Studien fand man heraus, daß sich Extrasystolen und Tachykardien bevorzugt bei vegetativ labilen Personen zeigen und
häufig durch stark belastende Lebensereignisse und Streß ausgelöst werden. In extremen Fällen kann dies sogar zum
plötzlichen Herztod führen.Neben unspezifischen Entspannungsmethoden, werden bei der Therapie vor allem Biofeedbackverfahren angewandt. Die
Patienten lernen, zunächst unabhängig von ihren spezifischen Symptomen, ihre Herzfrequenz zu vermindern oder zu erhöhen
und die Variabilität zu beeinflussen und erhalten so das Gefühl, ihre Herzfunktionen kontrollieren zu können.Herzneurose:
Obwohl es sich bei der Herzneurose, auch Herzphobie genannt, nicht um eine organische Erkrankung handelt, soll diese aufs
Herz zentrierte Angstkrankheit an dieser Stelle kurz erwähnt werden.Die Herzneurose unterscheidet sich grundlegend von der Angina pectoris oder dem Herzinfarkt, denn der Herzmuskel bleibt
bei ihr auch nach schwersten Anfällen vollkommen intakt. Dabei kommt es zu einer akuten Tachykardie von 120 bis 160
Schlägen/min, extremem Blutdruckanstieg und Schweißausbrüchen. Die Länge des Anfalls kann zwischen wenigen Minuten
und Stunden variieren. Der Patient ist bei vollem Bewußtsein und entwickelt heftige Todesangst und die Vorstellung eines
drohenden Herzstillstandes, obwohl eigentlich eine Kreislaufentgleisung vorliegt.Im Anschluß an den Anfall beginnt nun bei den Herzneurotikern eine auf das Herz zentrierte Angstkrankheit, die bei jedem
neuen Auftreten eines Anfalls von extremer Furcht vor Herzstillstand begleitet ist. Organisch gesehen ist das Herz der Patienten
aber völlig gesund, und sie erleiden einen wirklichen Infarkt sogar seltener als der Durchschnittsbürger. Mit der Zeit bilden die
Betroffenen hypochondrische Symptome wie ständiges Pulsmessen und Schonverhalten aus, und manchmal verlagern sich die
Ängste auch auf weitere Organe.Zur Behandlung ist sowohl eine aufdeckende Psychotherapie als auch Verhaltenstherapie mit Hilfe von Entspannungsmethoden,
Selbstkontrollstrategien oder Biofeedback notwendig.
3. Asthma bronchiale
Die Atmung dient vor allem dem Gasaustausch, der Aufnahme von Sauerstoff ins Blut und der Abgabe von Kohlendioxid.
Über den Kehlkopf und die Luftröhre (Trachea) gelangt die Atemluft in die beiden Hauptbronchien, die sich immer weiter
aufzweigen und schließlich in den Bronchiolen und Alveolen, den kleinen Lungenbläschen enden.Das Wort Asthma kommt aus dem Griechischen und bedeutet Atemnot und Keuchen. Als Asthma bronchiale bezeichnet
reversible Ventilationsbehinderungen auf entzündlicher Basis in einem hyperreagiblen Bronchialsystem. Die erschwerte Atmung
tritt in der Regel anfallsartig auf. Bei einem Anfall verengen sich krampfartig die Bronchiolen. Gleichzeitig schwellen die
Bronchialschleimhäute an und bilden ein zähes Sekret. Das führt zu einer weiteren Verengung und löst bei vielen Patienten einen
harten, quälenden Husten aus.Störungen des Atmungsvorganges kommen uns deshalb so angsterregend vor, weil Atmen und Lebendigsein in unserer
Vorstellung eng zusammenhängen. Die Römer z.B. besaßen nur ein Wort, nämlich "anima", für die drei Bedeutungen: Atem,
Seele und Leben.Außerdem ist die Atmung die einzige lebenswichtige Körperfunktion, die sowohl durch das vegetative Nervensystem gesteuert
wird, als auch willentlich beeinflußt werden kann. Man kann zum Beispiel "den Atem anhalten", aber andererseits muß man sich
im Schlaf nicht um seine Atmung kümmern. Auch stehen so wichtige emotionale Ausdrucksformen wie Sprechen, Schreien,
Lachen in enger Verbindung mit der Atmung.
Für die Entstehung eines Asthmaanfalls gibt es verschiedene Ursachen. Eine wichtige Rolle spielen die sogenannten Allergene.
Diese Reizstoffe lösen eine, vom Nervus vagus gesteuerte, Abwehrreaktion aus. Die Auswahl an Allergenen ist beinahe
unendlich groß: Blütenpollen, Sporen, Tierhaare, Hausstaub etc. Auch Medikamentenbestandteile und verschiedenste
Nahrungsmittel können als Allergene wirken. Der Grund warum diese Stoffe bei einigen Menschen allergische Reaktionen
hervorrufen ist noch nicht bekannt. Man nimmt aber an, daß bei diesen Personen generell eine gewisse Veranlagung zu
Überreaktionen vorhanden ist, da 50 % aller Asthmatiker auch an Hautallergien und Ähnlichem leiden.Obwohl längere Zeit daran gezweifelt wurde, steht heute fest, daß emotionale Reaktionen bei der Auslösung eines
Asthmaanfalls eine entscheidende Rolle spielen. Es kann sich dabei um starke Gefühlsbewegungen handeln, wie etwa große
Angst, Schrecken, Wut, Eifersucht, aber auch Freude und Erregung.Aus psychoanalytischer Sicht betrachtet weist das Asthma bronchiale auf eine gestörte Mutter-Kind-Beziehung hin. Der
Erwachsene leidet unbewußt noch immer unter Trennungs- oder Zuwendungsängsten. Man erklärt sich den Anfall als
unterdrückten Schrei nach der Mutter. Auch soll es eine Beziehung zwischen unterdrücktem Weinen und Asthma geben, denn
der vergebliche Versuch, mit dem Weinen aufzuhören, verursacht bei Kindern oft ein erstickungsähnliches Keuchen,
vergleichbar mit einem Asthmaanfall.Ein starkes auslösendes Moment scheinen auch verschiedenste Gerüche zu haben, mit denen der Asthmatiker zum Beispiel eine
Situation aus seiner Kindheit assoziiert. Der Therapeut Reinhart Stalmann beschreibt zu diesem Thema in seinem Buch
"Geheimnis der Psychosomatik" den Fall eines jungen Mannes, der nach seiner Rückkehr von einer Reise, während er am
Flughafen auf seine Frau wartete, einen plötzlichen Asthmaanfall erlitt. Der Mann, der vor diesem Zwischenfall übrigens noch
nie Probleme mit Asthma gehabt hatte, begab sich auf Anraten eines Arztes in psychotherapeutische Behandlung. Es stellte sich
heraus, daß der Mann eine sehr enge Beziehung zu seiner Mutter gehabt hatte, gleichzeitig aber immer mit seinem jüngeren
Bruder um ihre Liebe und Zuneigung konkurriert hatte. Seine Mutter beschrieb er als schöne, sehr gepflegte Frau, die immer
ein wenig nach Kölnisch Wasser duftete. Schon als Kind hatte er ständig Angst, ihre Liebe zu verlieren und hätte aus Trauer
und Wut darüber am liebsten geschrien. Diese Gefühle übertrug er später auf seine Frau. An dem Tag seines ersten
Asthmaanfalls am Flughafen trafen dann zwei Auslöser zusammen. Er sah seine Frau, die ihn jedoch noch nicht bemerkt hatte
und mit einem Flughafenangestellten sprach, was bei ihm unerklärliche Eifersucht auslöste. Kurz zuvor hatte er sich mit einem
Erfrischungstuch die Stirn abgewischt und hatte den Duft von Kölnisch Wasser noch in der Nase. Diese beiden Reize lösten
den schließlich den Anfall aus.Untersuchungen zur Persönlichkeit des typischen Asthmatikers ergaben das gehäufte Auftreten von Ängstlichkeit und
Schüchternheit, Empfindsamkeit und teilweise recht ausgeprägte zwanghafte Züge. Auch zeigte sich in einigen Studien, daß die
Betroffenen eher zu Hysterie, Hypochondrie und Depression neigen als der Durchschnitt.Vor allem hinsichtlich der Aggressionsproblematik zeigen Asthmatiker ein recht einheitliches Bild. Sie richten, auch schon auf
kognitiver Ebene, ihre Aggressionen nicht gezielt nach außen, sondern vielmehr bevorzugt gegen die eigene Person.Bei der medizinischen Therapie des Asthma bronchiale muß zwischen der Behandlung des akuten Anfalls und einer weiteren
Anfallsprophylaxe unterschieden werden.Zur akuten Behandlung werden heute vor allem Sprays verwendet, deren Wirkstoffe durch Inhalation eine Erschlaffung der
Bronchialmuskulatur bewirken. Da diese Substanzen aber dem Adrenalin sehr ähnlich sind, ist bei der häufigen Verwendung
Vorsicht geboten, weil ausgeprägte kardiale Nebenwirkungen, wie Herzrhythmusstörungen auftreten können.Beim allergischen Asthma ist oft ein Wechsel der Wohnung oder des Arbeitsplatzes angebracht, um eine weitere
Allergenexposition zu verhindern oder wenigstens zu minimieren. Ist dies nicht möglich, hat die Therapieform der
systematischen Desensibilisierung recht gute Erfolge erziehlt. Dabei werden dem Körper über Jahre hinweg steigende
Antigendosen verabreicht, und somit der Körper gezielt zur Bildung regulärer Antikörper veranlaßt.Bei der verhaltenstherapeutischen Intervention haben sich Biofeedback und das Erlernen von Entspannungstechniken, vor allem
der progressiven Muskelentspannung, bewährt.Eine andere Methode, die verbale Desensibilisierung, führt den Patienten schrittweise an die angstauslösende Situation heran,
mit der gleichzeitigen Instruktion ein vorher erlerntes Entspannungsverfahren einzusetzen.In manchen Fällen sind auch operante Verfahren hilfreich, dann nämlich, wenn die Asthmaanfälle ein verstärkendes Verhalten
darstellen, was vor allem bei Kindern der Fall ist. Sie scheinen nämlich gehäuft zu Anfällen zu neigen, wenn sie die
Aufmerksamkeit ihrer Eltern auf sich ziehen wollen. Durch ein Ignorieren dieser Anfälle, und somit dem Entzug des Verstärkers
kann eine deutliche Reduktion der Anfallshäufigkeit erreicht werden.Wie bereits geschildert, spielen aber anscheinend auch die Mutter-Kind-Beziehung und frühkindliche Erlebnisse eine große
Rolle, weshalb die Möglichkeiten einer psychoanalytische Therapie nicht außer Acht gelassen werden sollten.
4. Erkrankungen des Verdauungstrakts
Ulcus duodeni (Ulcus pepticum)
Die Zerlegung der Nahrung übernimmt in unserem Körper der Magen und das anschließende Duodenum - auch
Zwölffingerdarm genannt, da es circa zwei Handbreit lang ist.Durch die Aktivität der Magenmuskulatur wird die Speise vermischt, transportiert und durch spezifische Magenenzyme -
Pepsin in Verbindung mit Salzsäure - chemisch aufgespalten. Portionsweise wird der extrem saure Mageninhalt ans Duodenum
abgegeben und dort alkalisiert, so daß die Enzyme von Galle, Leber und Bauchspeicheldrüse wirksam werden können.Die Sekretion von Magensäure wird einerseits durch lokale Vorgänge im Magen und Duodenum gesteuert, abhängig von der
Zusammensetzung der Speise, kann aber auch von höheren autonomen Zentren beeinflußt werden. Den größten fördernden
Einfluß auf die Magenmotilität und die Salzsäureproduktion besitzt der Nervus vagus, der Hauptnerv des parasympathischen
Anteils des vegetativen Nervensystems.
In einer Reihe von Studien hat sich außerdem gezeigt, daß auch psychische Einflüsse, wie Emotionen, sowohl die Motilität als
auch die Säureproduktion verändern.Als Ulcus pepticum bezeichnet man gutartige Geschwüre in den Abschnitten des Verdauungstrakts, die mit Magensaft in
Berührung kommen. Dabei handelt es sich vor allem um die unteren Teile des Magens und die oberen des Duodenum.Von einem Ulcus spricht man, wenn die gesamte Schleimhautschicht durchdrungen wird. Die Gewebeschädigung kann einige
Millimeter bis wenige Zentimeter groß sein und ist meist scharf begrenzt.Der Patient hat starke Schmerzen im Oberbauch, die oft stundenlang anhalten können und, im Falle des Duodenumgeschwürs,
eine charakteristische Periodik aufweisen: häufig treten sie nach längerer Nüchternheit, zum Beispiel in der Nacht, auf und
verschwinden recht rasch nach der Einnahme von Medikamenten oder einer Mahlzeit. Bei den Magengeschwüren dagegen tritt
der Schmerz meist unmittelbar nach den Mahlzeiten auf.Ursache des Ulcus ist eine Selbstanstauung der Schleimhaut, die ihre Schutzfunktion gegen die produzierte Säure nicht mehr
erfüllt. In den letzten Jahren fand man außerdem heraus, daß die Besiedelung der Schleimhaut mit Heliobacter pylori diesen
krankhaften Mechanismus noch zusätzlich unterstützt.Als man in Untersuchungen nach möglichen Auslösesituationen für eine Ulcusentstehung suchte, stellte sich heraus, daß viele
der Erkrankten kurz vor Beginn der Beschwerden einem erhöhten "Life Event-Streß" ausgesetzt waren, das heißt, daß sie mit
ungewöhnlich vielen belastenden Lebensereignissen konfrontiert waren. Als weitere Risikofaktoren scheinen auch der Verlust
von Schutz, Anerkennung, Zugehörigkeit zu einer Gruppe und Geborgenheit, sowie ein Zuwachs an Verantwortung eine Rolle
zu spielen.Lange Zeit wurde der aktive, ehrgeizige und tüchtige Geschäftsmann als die typische Ulcuspersönlichkeit angesehen, daher
auch der Name "Wall-Street-Krankheit". Inzwischen ist man dazu übergegangen zwei Patiententypen zu unterscheiden. Bei
beiden Gruppen liegt ein Kernkonflikt zugrunde, nämlich der Wunsch einerseits in einer abhängigen, kindlichen Situation zu
bleiben und andererseits dem Streben nach Unabhängigkeit. Je nachdem, wie die Patienten mit diesen widerstreitenden
Wünschen umgehen, zeigen die einen als Kompensation ein hyperaktives, aggressives und ehrgeiziges Verhalten, während die
anderen eher anlehnungsbedürftig sind und zu Depressionen neigen.Der direkte Zusammenhang von Stressoren und einer Ulcusentwicklung ist für die Menschen noch nicht ganz geklärt. Mittels
Tierversuchen fand man aber heraus, daß wohl die Vorhersagbarkeit einer Streßsituation eine wichtige Rolle spielt. Zwei
Gruppen von Laborratten wurden jeweils durch leichte Elektroschocks einer Streßsituation ausgesetzt, wobei es ihnen
unmöglich war, den Stressor zu vermeiden. Während die eine Gruppe, die Schocks durch Signale angekündigt bekam,
erfolgten sie bei der anderen willkürlich und unvorhersehbar. Die Ergebnisse zeigten, daß die Ratten, die sich auf den Streß
"einstellen" konnten, deutlich weniger zu Geschwürbildung tendierten, als die Tiere, bei deren Versuchen keine
Vorhersagbarkeit gegeben war.Bei der medizinischen Therapie hat die grundsätzliche Umstellung des Patienten auf häufige kleinere Mahlzeiten allgemein gute
Erfolge erzielt, weil somit die Magensäure stets gebunden wird und die Schleimhaut nicht angreifen kann. Ähnlich wirken
säurebindende Medikamente, die sogenannten Antacida. Wichtig ist auch die Bekämpfung der Heliobacter pylori Besiedelung,
die meist in Kombination mit Antibiotika erfolgen muß, vom Patienten aber auch die Einhaltung bestimmer Diätregeln verlangt.
In besonders schweren Fällen, vor allem bei häufiger Wiedererkrankung mit der akuten Gefahr einer Perforation, kann ein
chirurgischer Eingriff in Form einer Entfernung der betroffenen Teile selten umgangen werden.Bei der psychotherapeutischen Behandlung kommen die bereits erwähnten Verfahren wie Entspannungstechniken, Autogenes
Training und Hypnose zum Einsatz. Ein besonderer Schwerpunkt bei der Ulcustherapie ist ein Streß-Management-Training, in
dem die Patienten lernen sollen, ihre Denk- und Verhaltensmuster in Bezug auf Streß zu ändern.Da die akuten Krankheitsphasen aber meist recht kurz sind, liegt das hauptsächliche Therapieziel in der Verhinderung eines
Rückfalls und einer erneuten Erkrankung.Colitis ulcerosa und Morbus Crohn
Diese beiden Krankheiten werden zu den Erkrankungen des unteren Verdauungstrakts gezählt. Die aufgenommene Nahrung
gelangt, nachdem sie zerkleinert und chemisch aufgespalten wurde, aus Magen und Zwölffingerdarm in den anschließenden
Dünndarm. Dieser erfüllt mit seinen über zwei Metern an Länge vor allem die Aufgabe der Resorption. Er mündet mit seinem
Endstück, dem Ileum, in den Dickdarm (Colon), wo dem Speisebrei Wasser und Elektrolyte entzogen werden, bevor er nach
Speicherung im Enddarm über den Mastdarm ausgeschieden wird.
Der Transport des Nahrungsbreis erfolgt durch Kontraktionen der Dünn- und Dickdarmmuskulatur, die hauptsächlich durch
ein darmeigenes Nervensystem erzeugt werden.
Bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn handelt es sich um entzündliche Erkrankungen, vornehmlich des Dickdarms, die beide
ähnliche Symptomatik und Entstehungsgeschichte aufweisen und deshalb zunehmend als zwei Formen einer Krankheit
betrachtet werden.
Bei der Colitis ulcerosa ist im besonderen der Enddarm (Rectum) betroffen, wobei sich die Veränderungen aber bis zum
Dünndarm hinaufziehen können. Das Hauptsymptom sind blutige, schleimige Stuhlentleerungen und Durchfälle. Außerdem
treten Allgemeinerscheinungen wie Fieber, Blutarmut und schwere Eiweiß- und Elektrolytverluste auf. Bei Komplikationen
kann es zu Fistel- und Narbenbildung, Perforationen oder Dickdarmkarzinomen kommen, es können aber auch in anderen
Organen, zum Beispiel in den Gelenken oder im Augenbereich, Veränderungen auftreten.
Morbus Crohn, auch Enteritis granulomatosa regionalis genannt, ist eine unspezifische Entzündung, bei der in 20 % der Fälle
das Ileum, in 20 % das Colon und in 60 % Ileum und Colon zusammen betroffen sind, nicht aber, wie bei der Colitis ulcerosa,
das Rectum.
Die klinischen Symptome sind recht uneinheitlich: Akute Durchfälle, Übelkeit und Brechreiz, aber auch krampfartige
Unterbauchschmerzen, weshalb oft die Fehldiagnose einer Blinddarmreizung bzw. -entzündung gestellt wird. Dann wiederum
folgen längere schmerzfreie Episoden mit uncharakteristischen Symptomen wie Fieber, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust.Die bereits bei der Colitis erwähnten begleitenden Entzündungserscheinungen im Bereich der Gelenke und Augen sind auch bei
Morbus Crohn zu beobachten.Während es für die Auslösung von Morbus Crohn keine gesicherten Zusammenhänge zwischen Lebensereignissen und
Krankheitsbeginn gibt, hat sich bei der Untersuchung von Colitispatienten gezeigt, daß diese vor ihrer Erkrankung oft einen
schweren Verlust erlitten hatten. Häufig der Tod eines Elternteils, oder anderen Personen, die dem Patienten sehr
nahegestanden hatten.Interessant ist auch die relativ typische Familiensituation der Erkrankten. Meist beschreiben sie ihre Mutter als den dominanten,
ja sogar herrschsüchtigen Elternteil, während der Vater häufig schwach und passiv dargestellt wird.
Im Zuge von Persönlichkeitsuntersuchungen hat man eine erhöhte emotionale Labilität bei Personen mit entzündlichen
Darmkrankheiten beobachtet. Colitispatienten sollen extrem feinfühlig und verletzlich sein, zwanghafte Züge aufweisen und zu
Depressionen neigen. Ihre Fähigkeiten zum Kontakt mit anderen sind reduziert, woraus oft Isolation und Absonderung
resultieren. Konflikte werden strikt durch Anpassung, Versöhnlichkeit und überbetonte Freundlichkeit oder umgekehrt durch
das Ausweichen vor Kontakten und durch Rückzug vermieden. Ähnliche Strukturen zeigen sind bei Morbus Crohn. Allerdings
sind diese Patienten zusätzlich unfähig zu Aggressionen und neigen dazu, selbstzerstörerische und ängstigende Phantasien zu
entwickeln. Die enge symbiotische Familiensituation der Colitis ulcerosa scheint zu fehlen und das Verhalten der Patienten mit
Morbus Crohn ist weniger von Bezugspersonen abhängig, als eher pseudoautonom. Aus diesem Grund ist die Bereitschaft zur
Psychotherapie bei Colitis-Patienten stärker ausgeprägt.Bei der medizinischen Therapie von akuten Schüben verwendet man hohe Dosen von Kortikosteroiden und bei schweren
Fällen muß vor allem auf den Ausgleich der Verluste von Blut, Eiweiß, Wasser und Elektrolyten geachtet werden. Nur bei
einem geringen Anteil der Patienten ist ein operativer Eingriff notwendig, bei dem dann der Dickdarm vollkommen entfernt, und
ein künstlicher Ausgang für das Ileum gelegt wird.Als psychische Behandlung wird bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn hauptsächlich die analytische Psychotherapie
eingesetzt. Dabei richtet sich die Wahl der Therapieform nach der Einteilung der Patienten in eine vornehmlich unabhängige,
aktive, oder eine eher abhängige, depressive Gruppe. Als sehr hilfreiche Art der Psychotherapie hat sich, vor allem bei
Patienten mit gehemmter oder mangelnder Ausdrucksfähigkeit, eine assoziative Mal-therapie bewährt. Die Erkrankten können
spontane Einfälle, Phantasien und Gedanken, sowie ihre angstbesetzten Gefühle bildlich darstellen und formulieren anschließend
ihre Assoziationen zu dem entstandenen Bild.
Sofern es sich nicht um äußerst schwere Fälle handelt, sind die Chancen auf eine Heilung relativ groß.Die Liste der angeführten Erkrankungen ist keineswegs vollständig. Für viele weitere Krankheiten, wie zum Beispiel Rheuma
und verschiedene Hautkrankheiten (Akne, Neurodermitis und Schuppenflechte), wird ein Großteil der Entstehungsursachen im
psychischen Bereich vermutet.
Psychische Symptome innerer Erkrankungen
Bisher wurden einige Krankheiten beschrieben, für deren Auslösung psychische Aspekte eine Rolle spielten. Allerdings kann
auch genau der umgekehrte Fall eintreten, nämlich, daß innere Krankheiten psychische Veränderungen hervorrufen. Die
folgenden Beispiele beziehen sich auf Erkrankungen des neuroendokrinen Systems, also auf Störungen der Produktion und
Sekretion innerer Drüsen des Körpers.Das Ausmaß der Symptome ist meist deutlich geringer als bei rein psychotischen Erkrankungen und nach Behandlung der
Grundkrankheit weitgehend reversibel.Hyperkortisolismus (Morbus Cushing)
Das Cushing-Syndrom ist ein klinischer Ausdruck einer gesteigerten Produktion von Glukokorticoiden, Androgenen und
Östrogenen, die meist von einer Störung des Gleichgewichts zwischen Hypothalamus, Hypophyse und Nebennierenrinde
herrührt.Die Patienten weisen einen erhöhten Blutzuckerspiegel (Steroiddiabetes) auf, und wegen der katabolen Wirkung der
Cortikoide kommt es an den peripheren Organen zu Muskelschwund und Osteoporose. Da auch der Fettstoffwechsel
verändert ist, beobachtet man typische Fettablagerungen am Körperstamm und im Gesicht (Vollmondgesicht).Die psychische Symptomatik ist nicht genau vorhersagbar, doch scheint am häufigsten (bei 80 % der Patienten) eine
Depression aufzutreten, die in einigen Fällen bis zur Suizidgefährdung gehen kann. Weiterhin zeigen sich paranoide Störungen,
dabei vor allem optische und akustische Halluzinationen und manchmal auch eine euphorisierende Wirkung der Steroide. All
diese Symptome zeigen sich vermehrt bei der Gabe von synthetischen Glukokorticoiden, z.B. bei Patienten mit chronischem
Asthma.Hyperthyreose
Unter Hyperthyreose versteht man eine erhöhte Produktion von Schilddrüsenhormonen, vor allem von Thyroxin und
Trijodthyronin. Unter den unterschiedlichen Formen der Hyperthyreose dürfte die wohl bekannteste der Morbus Basedow
sein. Die klinischen Zeichen betreffen fast jedes Organsystem: Typisch sind Kurzatmigkeit, gesteigerte Herzfrequenz und
Blutdruckamplitude, Rhythmusstörungen, Schweißausbrüche, Muskelschwäche, Diarrhoen und starker Gewichtsverlust.Das Ausmaß der psychischen Veränderungen scheint in engem Zusammenhang mit der Höhe der
Schilddrüsenhormonkonzentration zu stehen. Auffällig sind erhöhte Unruhe und Ängstlichkeit, Konzentrationsverlust,
emotionale Labilität bis hin zu depressiven Reaktionen. Bei einer schweren Hyperthyreose mit Entwicklung einer
thyreotoxischen Krise schlägt dann die Symptomatik von Unruhe und Ängstlichkeit um zu schwerer Lethargie, Somnolenz und
sogar Koma.
Durch eine zielgerichtete Therapie sind aber alle Symptome reversibel.Hypothyreose
Dabei handelt es sich um das Gegenteil der Hyperthyreose; Schilddrüsenhormone werden nicht in genügendem Ausmaß
gebildet. In Abhängigkeit von der Höhe der Hormonkonzentration und vor allem der Dauer der Hypothyreose findet man
ausgeprägte psychomentale Veränderungen. Da die Krankheit grundsätzlich einen verminderten Sauerstoffverbrauch
verursacht, zeigen sich eine Reihe von kognitiven Defiziten. Der hypothyreote Patient wirkt verlangsamt; eine auftretende
Depression kann alleine durch eine latente Hypothyreose ausgelöst worden sein. Auch zeigt sich eine deutliche Abnahme der
Libido; bei Frauen sind Zyklusstörungen ein häufiges Symptom. Wie bereits erwähnt spielt die Dauer des Hormondefizits eine
große Rolle: bei langjähriger Hypothyreose bleiben residuale Defekte zurück. Tritt der Mangel während der Entwicklungsphase
auf (z.B. beim Kleinkind durch Jodmangel), bleibt vor allem die Entwicklung des Nervensystems zurück und kann auch später
nicht mehr aufgeholt werden.Hyperparathyreodismus
Bei dieser Krankheit ist die Nebenschilddrüse betroffen. Das prominente Symptom ist ein erhöhter Blutkalziumspiegel, da die
Überfunktion der Nebenschilddrüse zu einer vermehrten Ausschüttung von Hormonen führt, die Kalzium aus den Knochen
abbauen.
Hyperparathyreodismus tritt bei Frauen circa zwei- bis dreimal häufiger auf als bei Männern, bevorzugt im 5. und 6.
Lebensjahrzehnt.Als klassische Beschwerden treten Nierenschädigungen, in chronischen Fällen mit Steinbildung, Knochenschmerzen und
Abnahme der Knochendichte auf, aber man kann auch milde psychiatrische Veränderungen beobachten. Diese äußern sich vor
allem in einer depressiven Verstimmung und kognitiven Störungen. Insbesondere eine Abnahme der Konzentrationsfähigkeit
und eine verminderte intellektuelle Aufnahmekapazität stehen im Vordergrund. Im Extremfall, dem höchst gefährlichen
Krankheitsbild der hyperkalzämischen Krise, ist der Patient dann somnolent, lethargisch und kaum mehr ansprechbar.Phäochromozytom
Beim Phäochromozytom handelt es sich um einen Tumor der Nebennierenrinde, der zu einer übermäßigen Produktion von
Katecholaminen führt. Die klinische Symptomatik schließt eine Reihe psychischer Symptome ein, die leicht fehlgedeutet werden
können, z. B. als Hyperthyreose oder vegetative Labilität.
Es zeigen sich ausgeprägte Unruhe, Nervosität und vor allem Angstzustände und Panikattacken. Falls gleichzeitig
Bluthochdruck und Kopfschmerzen mit den oben genannten Psychosymptomen vorliegen, sollte unbedingt an ein
Phäochromozytom gedacht werden.
Quellenangaben:- Uexküll, Thure von; Psychosomatische Medizin, 5. neubearbeitete und erweiterte Auflage
Urban und Schwarzenberg, München, Wien, Baltimore 1997
- Köhler, Thomas; Psychosomatische Krankheiten, 3. Auflage
Verlag W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart, Berlin, Köln 1995
- Stalman, Reinhart; Geheimnis Psychosomatik
Kindler Verlag GmbH, München 1979
- Karlson, Peter; Gerok, Wolfgang; Groß, Werner; Pathobiochemie, 1. Auflage
Thieme Verlag, Stuttgart 1978Bildnachweis:
Alle Abbildungen aus Uexküll, Psychosomatische Medizin (s.o.)Anschrift der Verfasserin:
Susanne Krell
Burgkmairstr. 56
80686 München
Diese Informationen und Veranstaltungshinweise
finden Sie auch in der Zeitschrift Naturheilpraxis des Pflaum-Verlages:
| Therapeuten: | Praxis Dr.Hemm |
Praxis A. Noll |