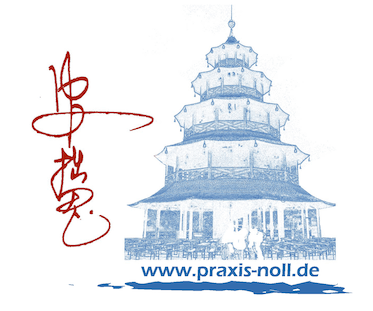Systemische Hyperthermie in der Behandlung maligner Tumoren
von Manfred D.Kuno, Berlin
Die Geschichte der Wärmeanwendung in der Therapie
von Geschwülsten ist uralt. So kannten beispielsweise bereits die
Heilkundigen der altägyptischen Hochkulturen die heilsame Wirkung der Wärme,
sie bestrichen Geschwülste der Haut und Tumoren der weiblichen Brust mit
lichtsensibilisierenden Pflanzenauszügen, um sie anschließend dem Sonnenlicht
auszusetzen.
Im Mittelalter war die Anwendung des Brandeisens in
der Behandlung vieler Geschwulstarten gefürchtete (aber wirksame) Behandlungsstrategie.
Nach dem Abklingen der ersten, sehr enthusiastischen
Phase der Zytostatikatherapie, nachdem klarer wurde, daß die moderne Chemotherapie
nicht den erhofften Durchbruch in der Tumorbekämfung erreichen würde, wurden
auch Weiterentwicklungen der Wärme- und Fiebertherapie vorangetrieben.
Auf dem Boden der großen Erfolge von COLEY und VON
JAUREGG in der Bekämpfung von Infektionen mittels Applikation von Pyrogenen,
entwickelten sich zwei Hauptanwendungsgebiete in der Wärmeanwendung:
a) die aktive Hyperthermie, bei der
mittels intravenöser Gabe von Pyrogenen hohe Fieberschübe provoziert wurden,
sowie
b) die passive Hyperthermie, die den
Körper des Krebskranken mittels physikalischer Techniken auf hohe Temperaturen
erwärmte.
Die passive Hyperthermie
Durch die Anwendung physikalischer Techniken ist
es heute möglich, gezielte Körperregionen oder den gesamten Körper eines
Menschen auf bestimmbare Temperaturen zu überwärmen. Zur Anwendung kommen
dabei verschiedene Techniken, von der Mikrowellen-, über die Ultraschall-
bis zur Infrarottechnik.
Der Begriff der Hyperthermie definiert sich dabei
durch die Überwärmung des Gesamtorganismus auf 40,0°C - 42.0°C (systemische
Hyperthermie) oder begrenzter Körperregionen auf über 42.0°C (regionale
Hyperthermie).
Praktiziert werden auch kombinierte Verfahren, wie
nachfolgend ausgeführt, sowie Kombinationen mit anderen Methoden der empirischen
Onkologie, die einen Einfluß auf die Wärmeregulation des Menschen haben
(z.B. Misteltherapie).
Die Anwendung der passiven Hyperthermie verfolgt
aus meiner Sicht wesentlich drei Ziele:
-
1. die direkte, selektive und irreversible
Schädigung von Tumorzellen,
2. die Stimulation tumorizider Immunmechanismen
(Apoptoseinduktion
und Anregung der zellvermittelten Tumor-Immun-Antwort)
und
3. die Modulation
der (bei Krebs gestörten) Wärmeregulation des erkrankten Organismus.
Ausgangssituation und Indikationsstellung
Vielerseits wird beschrieben, daß an Krebs erkrankte Menschen eine deutlich gestörte Wärmeregulation aufweisen. Dabei sind diese Störungen erkennbar an signifikant niedrigeren Tages-Temperaturprofilen bei Krebskranken gegenüber Krebsgesunden, die im Tagesverlauf starr und unbeweglich sind. Krebskranke weisen in der Anamneseerhebung sehr oft ein Fehlen von fieberhaften Erkrankungen über viele Jahre vor Ausbruch der Krebskrankheit auf. Sie geben oft an, über viele Jahre "gesund" gewesen zu sein, und machen dies an fehlenden fieberhaften Infekten fest. Demgegenüber muß festgehalten werden, daß die fieberhafte Reaktion auf z.B.grippale Infekte zu den normalen und "gesunden" Äußerungen immunologischer Aktivität gerechnet werden muß. Menschen mit jahrelang fehlenden fieberhaften Infekten müssen m.E. aus immunbiologischer Sicht als "gefährdet" eingestuft werden.
Auffällig ist auch, daß Patienten mit Krebserkrankungen
in der Regel ein hohes Wärmebedürfnis zeigen; schlechte periphere Durchblutung,
"kalte Füße", Tendenz zu muskulären Verspannungen der Extremitäten
bis hin zu Wadenkrämpfen ohne klinisches Korrelat (z.B. Kalium- oder Magnesiummangel),
sind häufig zu finden.
Gerade die anthroposophische Medizin hat sich über
Jahrzehnte forschend mit den zirkadianen Tagesrhythmen des Menschen beschäftigt
und belegt die Notwendigkeit der Temperaturreaktion als einen Ausdruck des
gesunden Organismus. Auch die Aktivität menschlicher Abwehrzellen unterliegt
solchen Zirkadianrhythmen. Interessant ist dabei, daß die Tageszeiten hoher
Temperatur beispielsweise übereinstimmen mit den Phasen erhöhter Killerzell-Aktivität.
Derlei Zusammenhänge konnten von HEINE auch hinsichtlich der Aktivität der Granulozyten belegt werden, die bei erhöhter Temperatur auch eine erhöhte Stoffwechselaktivität aufweisen (Leukozytolyse). Nach Gabe von temperaturstimulierenden Phytotherapeutika (z.B. nach Infusionen mit dem Mistelextrakt VYSOREL) zeigte sich eine deutlich erhöhte Leukozytolyse-Aktivität.
Die über Jahre in unserer Praxis gemachten positiven
Erfahrungen in der Anwendung immun- und temperaturstimulierender Mistelextrakte
bewegten uns vor einiger Zeit, die Krebsbehandlung um die Anwendung der
systemischen und regionalen passiven Hyperthermie zu erweitern. Dabei bezogen
wir v.a. zwei Patientengruppen in diese (nachfolgend beschriebene) Kombinationsbehandlung
ein:
-
1. Patienten nach kurativer chirurgischer Intervention
2. Patienten in inkurablen, "austherapierten" Krankheitsstadien.
In der ersten Patientengruppe kombinieren wir die
regionale Infrarot-Hyperthermie des Operationsfeldes und der Lymphabflußwege
mit der systemischen, niedrigdosierten Gabe von Mistelextrakten (in diesem
Fall VYSOREL).
Bei der zweiten Patientengruppe setzen wir die systemische
Hyperthermie (Ganzkörpererwärmung auf 40,0°C) ein, und kombinieren diese
mit der Anwendung lokaler, wassergefilterter Infrarot-Bestrahlung in der
Hochtemperaturphase. Zudem infundieren wir in dieser Phase eine Hochdosis
eines wässrigen Mistelauszuges (VYSOREL). Letzteres soll das Ziel verfolgen,
die thermisch vorgeschädigten Tumorzellen durch die intravenöse Mistelgabe
zusätzlich zu schädigen.
Wir verfolgen also bei der Patientengruppe 1. sekundärpräventive
Ziele, während wir bei der Patientengruppe 2. direkte zytostatische Wirkungen
anstreben.
Die Wärmeanwendungen erfolgen gemäß der in der Deutschen
Gesellschaft für Hyperthermie (DGH) festgelegten Richtlinien, deren Mitglieder
wir sind.
Vorauswahl der Patienten
Alle Patienten, bei denen eine Hyperthermiebehandlung
durchgeführt werden soll, müssen sich vor Beginn der Behandlung einer gründlichen
internistisch-kardiologischen Abklärung unterziehen. EKG, Belastungs-EKG,
pO2-Messung, Spirometrie, sowie Serochemische Bestimmung von Herzenzymen,
Mineralen, und Gerinnungsstatus sind obligatorisch.
Patienten mit Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris,
nach Herzinfarkt, Apoplexie, Thrombose oder Thrombophlebitis, sowie Patienten
in reduziertem Allgemeinzustand werden von der Hyperthermiebehandlung ausgeschlossen,
da das Risiko für bedrohliche Komplikationen aus grundsätzlichen Erwägungen
minimiert werden muß. Ein gesichertes Hirnödem (z.B. bei Patienten mit Hirntumoren
und/oder Hirnmetastasen) sind von der Hyperthermiebehandlung ebenfalls ausgeschlossen.
In der ersten Patientengruppe (Sekundärprävention) wird über einen Zeitraum von drei Monaten eine zweimal wöchentliche Behandlung durchgeführt, bei der eine lokale Gewebsüberwärmung über 30 Minuten mittels einem wassergefilterten Infrarot-Strahler (HYDROSUN-500-Strahler) angewandt wird. Während der Bestrahlung erfolgt parallel eine intravenöse Applikation eines niedrig dosierten wässrigen Mistelauszuges (VYSOREL).
Die Wärmeanwendung erfolgt direkt in die Operationsregion
(Tumorbett), sowie in die Weichteilregionen der Lymphabflußwege.
Eine Kontrolle der Behandlungseffektivität erfolgt
über klinisch-onkologische Beobachtung, sowie über die Bestimmung der spezifischen
Tumormarker und der jeweiligen Immunstaten aus dem Blut des Patienten.
Durchführung der systemischen Hyperthermie in der
immunbiologischen Tumorbehandlung
Angesichts der Tatsache, daß rund 80% der krebsbedingten Todesfälle nicht durch den Primärtumor, sondern durch Metastasen verursacht sind, angesichts aber auch der ganzheitlichen Grundkonzepte, die eine Krebserkrankung als eine primär systemische Erkrankung verstehen, hat unser Therapiebestreben auch eine dementsprechend systemische Zielrichtung. Durch die Kombination der Ganzkörper-Hyperthermie mit der systemischen Anwendung der Mistel (und anderer systemisch wirksamer Verfahren, wie orthomolekulare und Enzymtherapie, Thymus- und Splenopeptidpräparate, Psychotherapie und Homöoapthie) bemühen wir uns, die systemische Erkrankung auch systemisch zu behandeln.
Im Fall der fortgeschrittenen, klinisch inkurablen,
disseminierten Krebskrankheit, sind (meist unter zeitlicher Limitierung)
vordringlich tumordestruktive Therapieverfahren erforderlich. Die Zurückdrängung
maligner Tumormassen steht im Vordergrund der Maßnahmen. Zeit zu gewinnen
ist das leitende Motto, das uns die nachfolgend beschriebenen Behandlungskombinationen
wählen läßt.
Die Patienten werden nach (oben beschriebener) internistisch-kardiologischer
Abklärung in 2-4 wöchigem Abstand einer Serie von 5-15 Hyperthermiebehandlungen
unterzogen. Jede Behandlung erfolgt ambulant, aber unter intensiver Beobachtung
und Überwachung mittels EKG-, und Oximetrie-Monitoring, Puls- und Blutdruckkontrolle,
sowie kontinuierlicher Überwachung der Körperkerntemperatur per rektalem
Temperaturfühler. Alle Beobachtungsparameter werden genau dokumentiert.
Jeder einzelne Hyperthermieprozeß dauert insgesamt
etwa 4 Stunden, anschließend können die Patienten mit Begleitperson wieder
nach Hause fahren.
Die Hyperthermiebehandlung gliedert sich in vier Phasen:
1. Vorbereitung
Die Patienten legen sich mit einem leichten Baumwoll-Schlafanzug die zeltartige Hyperthermie-Kabine (s.Abb.), erhalten einen intravenösen Zugang mit einer Mineralstofflösung (RINGER-Lsg.), sowie die Ableitungen für die Überwachungsgeräte. Der Kopf des Patienten wird außerhalb der Kabine gelagert (s.Abb.), sodaß die Patienten falls gewünscht eine Entspannungs- oder Mediationskassette über Walkman hören können.
2. Überwärmung ("Wärmeeskalation")
Nach Abschluß der Vorbereitungen wird die Kabine mit Klettbändern geschlossen, und die im Kabinendach befindlichen vier Infrarotstrahler werden eingeschaltet. Die Strahler sind so angeordnet, daß sie eine breit streuende, diffuse Infrarot-Wärmestrahlung abgeben. Verbrennungsgefahr besteht bei der von uns angewandten Technik (INFRAROTSYSTEM nach HECKEL) nicht. In einem nun folgenden Zeitraum von 45-90 Minuten wird der Patient kontinuierlich auf die gewünschte Temperatur erwärmt. Wir streben dabei eine Zieltemperatur von ca. 39.5°C bis 40,0°C an. Erfahrungsgemäß heizt der Organismus nach Abschalten der Strahler noch etwa 0,5°C spontan nach, sodaß eine Ganzkörpertemperatur von ca. 40,0°C bis 40,5°C erreicht wird.
Die geschlossene Hyperthermiekabine, die innen mit
reflektierenden Folien ausgestattet ist, verunmöglicht dem Organismus die
reaktive Temperatursenkung durch Schwitzen und Oberflächenkühlung, da die
Kabine vollständig luftdicht geschlossen ist. Demenstsprechend stark ist
die beim Patienten einsetzende Schweißsekretion, der mit der RINGER-Infusionslösung
begegnet wird.
Um eine schnellere Wärmeverteilung im Organismus zu
erreichen, verwenden wir eine auf 38.5°C vorerwärmte Infusionslösung.
3. Wärmestau und ergänzende Maßnahmen
In der Hochtemperaturphase wird der Patient nach
Abschalten der Wärmestrahler in die leichten Kabinenfolien eingewickelt,
es wird somit eine Wärmestaupackung angewandt, die die Temperatur über mehrere
Stunden auf dem erreichten Plateau halten kann. Wir führen in dieser Phase
eine zusätzliche ca. 30minütige regionale (perkutane) Bestrahlung des Tumorfeldes
mittels wassergefiltertem Infrarot-Strahler (HYDROSUN 500-Strahler) durch,
über den per Konduktionswärme nun auch tiefe Gewebsschichten auf tumorizide
Temperaturen (>41,5°C) überwärmt werden können. Der Patient verspürt
hierbei keine Beschwerden, Verbrennungen sind bei der eingesetzten Technik
nicht möglich.
Parallel erhaält der Patient nun über den intravenösen
Zugang eine hochdosierte Mistelinfusion (in unserem Falle VYSOREL), die
die nun thermisch vorgeschädigten Tumorzellen weiter schädigen soll.
Nach diesen Behandlungsvorgehen wird der Patient noch
etwa 1 Stunde in der Wärmestaupackung belassen.
4. Wärme-Deeskalation
Nach Öffnen der Wärmestaupackung und Abdekcen mit trockenen Laken sinkt die Temperatur des Patienten kontinuierlich im Lauzfe von ca. 3-4 Stunden auf normale Temperaturwerte ab. Die Patienten können bei einer Temperatur von rund 38,0°C in Begleitung nach Hause entlassen werden. In manchen Fällen beschreiben die Patienten einen neuerlichen spontanen Temperaturanstieg auf etwa 39.0°C, der etwa 6-8 Stunden nach der Behandlung einsetzt, und ohne weitere Maßnahmen nach 1-3 Stunden Dauer wieder abklingt.
Subjektives Empfinden
Die Patienten empfinden die Behandlung selbst als
anstrengend. Vor allem die Wärmeeskalation unter kontinuierlicher Einwirkung
der vier Wärmestrahler wird oft als lästig oder schwierig zu ertragen bezeichnet.
Bei entsprechender personeller Betreuung (Gespräche, Abtupfen der Stirn
mit einem feuchten Lappen, trinken von Wasser oder Tee, oder auch der Gabe
von leichtem Obst) ist der Therapievorgang in aller Regel gut durchführbar.
Probleme treten bei Patienten mit klaustrophobischer Anamnese auf, aber
auch hier kann durch gute Betreuung und ggf. Gabe von intravenöser Magnesium-Caclium-Mischung
problemlos aufgefangen werden.
Nahezu alle Patienten beschreiben, daß nach einer
Phase der Erschöpfung, die etwa 1-2 Tage anhält, ein ausgesprochen vitales
Körpergefühl besteht, was über das Ausgangsbefinden deutlich hinaus geht.
Hinzu kommt, daß einige Patienten ein anhaltend gut durwärmtes Körperempfinden nach den Behandlungen beschreiben, was ihnen Jahre bis Jahrzehnte vorher nicht gegeben war. Möglicherweise (und dies bleibt zu objektivieren) deutet dies eine modulierende Wirkung in der Wärmeregulation der Patienten an.
Objektive Verträglichkeit
Im Rahmen der von uns bisher durchgeführten Hyperthermiebehandlungen
kam es anfänglich zu Problemen, wenn wir die Behandlung mit Kopf-Innen-Lagerung
durchführten. Seit wir generell den Kopf außerhalb der Wärmekabine lagern,
sind keine nennenswerten Probleme mehr aufgetreten.
Lediglich bei einem Patienten mit Bronchialkarzinom
kam es überraschend zu einem plötzlichen Herz-Kreislaufkollaps mit Bradycardie
von 52 Schlägen/Min., Blutdruckabfall auf 60/0mmHg und Abfall des pO2 auf
82%. Die Gabe schnelle Infusion eines Plasmaexpanders (GELIFUNDOL), Injektion
von 10ml MAGNESIOCARD und Sauerstoffgabe ließen die Situation in wenigen
Minuten wieder entspannen.
Da der Patient (immerhin ein 2m großer durchtrainierter
Leistungssportler) aufgrund seiner Grunderkrankung parallel Zytostatika
erhielt, die als Nebenwirkungen auch kardiotoxische Seiteneffekte erwarten
lassen, haben wir ihn zur Abklärung an einen Kardiologen überwiesen, bevor
die Hyperthermiebehandlung fortgeführt wird.
Sofern also die oben ausgeführten Ausschlußkriterien
beachtet und die internistisch-kardiologische Abklärung keine Kontraindukationen
bietet, sofern weiterhin (und dies scheint mir erforderlich) eine adäquate
Überwachung des Patienten gewährleistet ist, kann die systemische Hyperthermie
als gut verträgliche immunbiologische Tumorbehandlung eingestuft werden.
Angesichts der Tatsache, daß wir diese Behandlungsstrategie
in unserer Praxis in dieser Kombination erst seit etwa 6 Monaten durchführen,
kann noch keine Aussage zur Wirksamkeit gemacht werden.
Es scheint mir aber zumindest ein technischer Entwicklungsstand
vorzuliegen, der die (über Jahrhunderte ersehnte) Möglichkeit bietet, Tumorpatienten
eine wirksame, kombinierte und systemische Überwärmungsbehandlung bei Tumorerkrankungen
anzubieten. Ich werde zu gegebener Zeit an dieser Stelle über die Langzeitwirkungen
dieser Therapievariante berichten.
Empfehlung weiterführende Literatur:
HAGER, E.D., ABEL, U.: Biomodulation und Biotherapie des Krebses,
Verlage f.Medizin Dr.E.Fischer, Heidelberg 1987
HAGER,E.D.: Komplementäre Onkologie, Forum Medizin Verlag,
Gräfelfink 1996
HECKEL, M.: Ganzkörper-Hyperthermie und Fiebertherapie,
Hippokrates, Stuttgart 1990
KUNO, M.D.: Krebs in der Naturheilkunde, R.Pflaum Verl.,
München 1998
Korrespondenzanschrift:
Manfred Kuno
Peter-Strasser-Weg 35
12101 Berlin
Tel. 785 71 51
Fax. 785 82 12
Entnommen den berliner heilpraktiker nachrichten