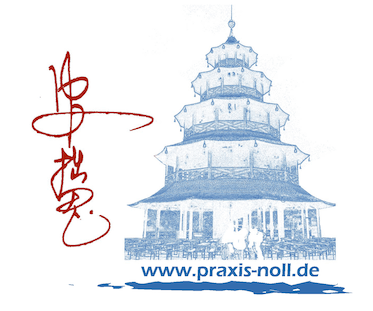Psychotherapie bei psychosomatischer
Störung unter Verwendung von Hypnose
Von Hellmuth Schuckall
Eine, wenn auch nicht immer entsprechend beachtete
Binsenweisheit für ein wirksames therapeutisches Handeln ist, daß zwischen
Behandler und Patient eine dialoghafte Beziehung entstehen muss, die in großen
Teilen von einer gemeinsamen Sprache getragen wird. Wie jede andere lebendige
Sprache zeichnet sie sich dadurch aus, daß es einen gemeinsamen Interpretationsraum
für die verwendeten Begriffe und Bezeichnungen gibt, so daß zwischen Absender
und Empfänger der Botschaft Einigkeit darüber besteht, was die versandte Information
tatsächlich beinhaltet. Dies gilt in besonderem Maße dort, wo der Dialog innerseelische
Zustände, gefühlsmäßige Wirklichkeiten und Gegebenheiten zum Gegenstand wählt,
nämlich in der Psychotherapie.
Geht man Idealerweise davon aus, daß es im Prozess einer Psychotherapie ein
gemeinsames Bemühen um die Koordination und Abstimmung dieser "Beziehungssprache"
gibt, treten immer wieder und u. U. systematisch Situationen auf, wo trotz
eines gemeinsamen Wollens eine Grenze erreicht wird, an der jene Sprache,
ja sogar der Versuch der Sprachfindung, regelmäßig vom Versagen bedroht ist.
Es gibt seelische Erkrankungsformen, die typischerweise durch eine innerseelische
Sprachlosigkeit kennzeichnet sind, - die sogenannten psychosomatischen Krankheiten.
Die sprachlich-seelische Vermittelbarkeit ist wegen dieses Sprachmangels regelhaft
gefährdet, weil im affektiven Erleben des Patienten schnell gefühlsmäßige
Situationen erreicht werden, wo für die auftretenden Zustände und Gestimmtheiten
kein verbalisierbares seelisches Instrumentarium mehr zur Verfügung steht.
Das Symptom selbst, üblicherweise der Anlaß für ein Sprechen "über"
wird zum eigentlichen Idiom, das an die Stelle des innerseelisch geformten
Begriffs treten muss, für welchen ansonsten das affektive Wort als treffliches
Symbol zur Verfügung steht;- das Wort, das im Regelfall entstanden war, nachdem
es durch den üblichen intraseelisch-abstrahierenden Prozess einer affektiven
Analyse und Wandlung in die intellektuelle Differenzierung gegangen sein mußte,
um als Endprodukt dieses Prozesses schließlich zum geeigneten seelischen Begriff,
zur Metapher, zum Gefühlswort zu werden. Das bedeutet, psychosomatische Krankheit
tritt dann auf, wenn eben komplexes innerseelisches Geschehen in keiner Weise
ein adäquates und damit vermittelbares Affektwort findet, mit dessen Hilfe
Gefühle und Empfindungen in die Wirklichkeit der Welt gelangen können. In
freier Erweiterung Wittgenstein's Postulat, wonach erst das Wort einen potentiellen
Inhalt existentiell sein läßt, entpuppt sich der Träger der psychosomatischen
Krankheit als ein Subjekt, das in weiten Teilen seiner eigentlichen Subjekthaftigkeit
beraubt ist, in dem es wesentliche Anteile seines inneren Erlebens nicht kennzeichnen
kann und deshalb in wesentlichen Persönlichkeitsanteilen im vorbewußt schwebenden
Raum einer archaischen Organsprache verbleiben muß.
Psychoanalytisch orientierte Entwicklungsmodelle gehen davon aus, daß die Sprache der Affekte und ihre komplexe Differenzierung prozesshaft in der Beziehung zwischen Mutter und Kind entsteht,- im Kontext der frühen mütterlich-umsorgenden, affektiven Benennung jener ursprünglichst auftretenden Empfindung von Schmerz und Angst wie auch von Lust, Freude, Hunger und Durst oder anderen Primärreaktionen. Durch ihre Empathie, ihre Hilfe und Anleitung werden diese Primäraffekte aus dem elementaren primärprozeßhaften Grundmuster biologisch-reaktiven Seins, tausendfach qualitativ wie quantitativ relativiert und modifiziert, in die Abstraktion und damit sprachlichen Verfügbarkeit transponiert. Diese umsorgende mütterliche Zuwendung, die dem kindlichen Affektausdruck ein treffendes gefühlsmäßiges Wort verleiht, schafft erst die Fähigkeit des Kindes, über die eigenen Affekte gefühlsmäßig sprechen zu können. Bei den Trägern psychosomatischer Krankheit scheint dieser ursprüngliche Prozeß der "Gefühlsverwirklichung" mittels der Mutter-Kind-Interaktion nur marginal oder z.T. sogar ganz unterblieben zu sein. Wer sich therapeutisch mit dem typisch psychosomatisch Erkrankten beschäftigt, wird vergleichsweise rasch und begrenzend auf diese, im Extremfall als Alexithymie bezeichnete Begriffs- und Wortlosigkeit für seelische Gegebenheiten stoßen. Der tiefenpsychologisch orientierte Weg muß üblicherweise mit den Phantasien, Projektionen und Imaginationen der Patienten kooperieren, als die einzige Möglichkeit, die destruierenden Traumata und Strukturen zu identifizeren, aufzudecken , schließlich kompensatorisch zu bearbeiten und seelisch integrierbar werden zu lassen. Dort, wo aber dieses innerseelisch-sprachliche Instrumentarium nicht entsprechend ausgebildet werden konnte, muß logischerweise der therapeutische Deduktionsprozess zunächst an eine Mauer stoßen. Psychosomatische Krankheiten bedürfen deshalb im Kontext der tiefenpsychologischen Therapie enormer Geduld (und eines kaum mehr vertretbaren Stundenrahmens), denn für jedes nicht vorhandene affektive Wort muß in der Beziehung zum Therapeuten mühselig eine passende Begrifflichkeit erarbeitet und nachgeholt werden, was in aller Regel außerordentliche Schwierigkeiten bereitet und vom Therapeuten eine immense Bereitschaft fordert, permanent gefühlsmäßige Analogien und potentielle Vergleichbarkeiten zu einem unspezifisch hervorgebrachten Affekt zu suchen und zu finden, so daß der Patient auf diese Weise die Sprache der Gefühle regelrecht erlernen kann.
In vielen Fällen funktionieren allerdings auch solche Therapieanstrengungen nicht, weil die notwendigen Sprachcodes in herkömmlich tiefenpsychologischer Weise einfach nicht zu finden sind.
Bei der theoretischen Überlegung wie einem derartigen
Kommunikationsdefizit zu begegnen wäre, bietet sich in erster Annäherung die
Hypnose als eine grundsätzlich geeignete Hilfskonstruktion an, die wegen ihrer
primärprozesshaft anmutenden, viel-sinnlich affektiven Bildsprache als Kompensationsinstrument
gut geeignet erschiene. Bei konsequenter Betrachtung einer solchen Möglichkeit
entpuppt sich dann die Ericksonsche Hypnotherapie bereits vom theoretischen
Ansatz her als das potentiell wohl geeignetste Verfahren. Denn ein herausragendes
Kriterium beim Ericksonschen Weg der Hypnosenutzung findet sich im therapeutischen
Angebot der sogenannten Utilisation. Mit diesem Begriff ist definiert, dass
grundsätzlich nur solche Affekte und Erlebnisse hypnotherapeutisch genutzt
werden dürfen, die aus dem sinnlich erfahrenen Lebens- und Gedankenraum des
Klienten stammen, was den besonderen Vorteil hat, dass das imaginativ Erfahrbare
als wirklich und wahr im Seinerleben anerkannt werden kann, weil es als historisch
korrekt für das betreffende Leben identifizierbar ist. Zum anderen vermeidet
dieser Weg weitgehend jene fragwürdige Künstlichkeit und damit potentiell
seelische Unglaubwürdigkeit durch eine u.U. individuell wesenfremde Manipulation
aus dem Erlebensraum des Anderen (Therapeuten), was somit konzeptionell mit
dem psychoanalytischen Ethos ebenfalls gut vereinbar erscheint.
Die Überlegung zielt nun dahin, reales Erleben des Patienten, das in seiner
deskriptiven Faktizität aus dem Text der therapeutischen Stunden ja durchaus
vorliegt, mit den sinnlichen Eindrücken der hiermit verknüpften Erinnerung
wieder er- und -belebend zu kontaminieren, auf diesem Weg eine affektive benennbare
Vermengung zu induzieren, die im Laufe des stattfindenden, kontinuierlichen
therapeutischen Erlebensprozesses schließlich auch eine gefühlsmäßig genaue
Bestimmbarkeit des Wiedererfahrenen ermöglichen könnte. Wenn nämlich ein tatsächliches
Ereignis mit einer ganzheitlich-affektiven Sinneserfahrung kooperiert, müßte
es nicht allzu schwer sein, das hierfür vorgeschlagene Wort oder den trefflichen
affektiven Begriff zu verknüpfen, um damit als sprachliche Ausdrucksmöglichkeit
wirklich und verfügbar werden zu können. Diese neu gewonnene Wirklichkeit
wiederum ermöglichte dann dieses Sprechen in der Analogie des "als ob",
was es für den Patienten leicht machte, die hierfür vom Therapeuten vorgeschlagene
oder selbst gefundene gefühlsmäßige Benennung als eine auch tatsächlich stattfindende
Gegebenheit wahrzunehmen, um sie (auch in Zukunft) in die Abstraktion des
sprachlichen Ausdruckes übersetzen zu können.
In der folgenden Fallvignette soll diese gedankliche Möglichkeit und der daraus folgende Prozess,- der pragmatische Einbau von hypnotherapeutischen Techniken in eine psychoanalytisch orientierte Therapie,- stichpunktartig dargestellt werden. Vorab soll nicht unerwähnt bleiben, daß die Verwendung von Hypnose durchaus ihre eigenen Probleme in Bezug auf die Übertragungssituation ausübt und immer wieder der Klärung bedarf, was aber in diesem Beitrag nicht Gegenstand der Überlegung sein soll.
Die Patientin ist eine zu Therapiebeginn 31-jährige
Informatikerin, bei der vor etwa 3 Jahren der ersten Schub einer Multiple
Sklerose aufgetreten war, typischerweise mit initialer Sehstörung und imperativem
Harndrang. Zu Anfang gehörten auch Gangunsicherheit, eine Störung der Tiefensensibilität
in den unteren Extremitäten und eine leicht rechtsbetonte Taubheitsempfindung
in den Fingerspitzen dazu, seelisch vergesellschaftet mit einer latent aggressiv
-dysphorischen Grundgestimmtheit.
Unter Hochdosis-Cortisonbehandlung und anschließender Dauermedikation mit
einem klassischen, neueren MS-Präparat sowie unter Komedikation mit proteolytischen
Enzymen verschwanden die somatischen Krankheiterscheinungen bis auf die Empfindungsstörungen
in den Fingern zunächst ziemlich weitgehend. Im Kontext familiärer und partnerschaftlicher
Auseinandersetzungen jedoch traten regelhaft immer wieder kleiner Schübe auf,
die von ernsteren depressiven Verstimmungen aber auch unspezifischen Aggressionsausbrüchen
begleitet waren und wenig zur ansonsten recht bestimmend- rationalen Gestimmtheit
der Patienten zu passen schienen. Es wurde zunehmend deutlicher, dass insbesondere
Trennungssituationen derartige Schübe initiierten.
Wie die Patientin berichtete hatte sie seit der Pubertät immer wieder Partnerbeziehungen,
die jeweils nur vergleichsweise kurz hielten, obschon die Patientin betonte,
alles in ihrer Macht stehende für diese Beziehungen getan zu haben. Häufig
angeführte Gründe für die Trennungen (stets durch die Beziehungspartner initiiert)
waren Vorwürfe wie "zu wenig Austausch,..du läßt mich nicht an dich heran,..ich
wusste nie wirklich, was in die vorgeht, ...irgendwie bleibt nie etwas etc".
Diese vergleichsweise unspezifischen Vorwürfe und recht vage erscheinenden
Trennungsargumente wurden allerdings rasch gefühlsmäßig verständlich, wenn
man die Persönlichkeit der in ihrem Erscheinungsbild durchaus ansehnlichen
Patientin erlebt. Im Gespräch zeigt die junge Frau, die sich formal freundlich
zugewandt und um Kontakt bemüht gibt, als durch und durch rationalisierend,
ideologiehaft kühl und scheinbar gefühlsmäßig unbeteiligt argumentierend,
dabei von bestechender intellektueller Brillanz und Eloquenz. Sie schildert
eine Kinder- und Jugendsituation in der sie, früh paternisiert überwiegend
als narzistisches Objekt einer infantil erscheinenden Mutter zu fungieren
hatte.
Sie beschreibt nach vergleichsweise wenigen Stunden und dabei außerordentlich
präzise in der Schilderung eine Reihe schwerer kindlicher Entwertungssituationen
und Traumata, die sie im Laufe der weiteren Therapiestunden noch detaillierten
ausführen kann, was in der emphatischen Anteilnahme beim therapeutischen Gegenüber
z.T. ausgesprochen anhaltende Wutempfindungen und Verstimmungen sowie kompensatorisch
auch rege Vorstellungen und Phantasienproduktionen hinterließ.. Von all diesen
Affekten scheint die Patientin selbst wenig bewusst zu erleben. So beschreibt
sie ihr Erleben mit der gleichen professionellen Sachlichkeit mit der sie,
medizinisch-terminologisch korrekt, auch ihre neurologischen Ausfälle darstellt.
Erst nach langen Stunden ist es ihr möglich, über eine dumpfe Depressivität
zu klagen, von der sie sich beschnitten fühle., die sie "irgendwie"
auch als Grund für ihre Trennungen ansieht. Bei der näherer Betrachtung des
Beziehungsgeschehens gelingt es ihr allmählich so etwas wie einen Trennungsschmerz
und Verlassenheitsgefühle zu beschreiben und ihre Ohnmachtsempfindungen mit
annäherungsweise plastischen Adjektiven derart anzureichern, dass sich eine
gefühlsmäßige Unmittelbarkeit zwischen geschildertem seelischen Erleben und
den Faktengeschehnissen der Trennung herstellen lässt.
Zur Demonstration für die Praxis einer hypnotherapeutischen
Intervention innerhalb einer laufenden Therapie soll eine Trennungssituation
herangezogen werden, die sich innerhalb der ersten 50 Stunden dieser psychoanalytischen
Therapie ereignete. Im Kontext eines mit dem Beziehungspartner unternommenen
Badeurlaubs an der belgischen Nordseeküste hatten die schon länger diffus
schwelenden Beziehungsprobleme zugenommen und erreichten gegen Ende der Ferien
ihren Höhepunkt, wo der Partner andeutete, dass er sich trennen wolle. Bei
Rückkehr aus dem Urlaub wurde die Trennung dann entgültig, wobei die Patientin
zunächst als Begründung anführte, dass sie während des Urlaubs auch Fahrradtouren
allein unternommen habe, was den Partner wohl so gekränkt habe, dass er den
Trennungsschritt unternommen habe. Der Auseinandersetzung waren einige Tage
am Strand vorausgegangen, wo sich die Patientin sehr wohl gefühlt hatte und
offenbar auch durchaus bewusst ihr gegenwärtiges Erleben, ihren Partner wahrgenommen
und intensiv mit sich und einem intensiven Naturerlebnis in Beziehung setzen
konnte, wie die spätere Rekapitulation des Geschehens ergab.
Im Laufe der Schlüsselung der tatsächlichen Ereignisse wurde dann aber deutlich,
dass die Patientin in der ihr typischen Weise selbst sehr zärtliche und intime
Situationen ohne nennenswerte seelische Regungen und gefühlsmäßig anteilnehmende
Kommunikation behandelt hatte und kaum über das Deskriptive im Dialog hinausgekommen
war, was den Partner wohl "im Regen hat stehen lassen", obschon
die Patientin, wie sich in den Therapiestunden herausstellen sollte, durchaus
ein sehr reichhaltiges und differenziertes Gefühlserleben erfahren hatte,
an dem sie ihren Partner allerdings hatte nicht teilhaben lassen können. Die
Beschreibungen jener Tage umriß eine Vielzahl sehr inspirierender, vom Naturschauspiel
und der partnerschaftlichen Nähe ungewöhnlich involvierender Momente und Situationen,
deren affektive Korrelate sich jedoch nur auf Adjektive wie "so schön
und so ruhig" oder "ich hab mich so richtig wohl gefühlt" oder
"war ganz angenehm" etc. beschränkten.
Erst im therapeutischen sprachlichen Angebot, das für die verschiedenen Situationen
gefühlsmäßig genauere und erlebnisorientierte Bilder und Vergleiche (aus den
Schilderungen der Patientin gezogen) anbot, gelang es der Patientin erstmalig,
ein sehr genaues Bild ihres tatsächlichen seelischen Erlebens zu vermitteln,
wo sich Patientenerleben und die indentifikatorische Empathie des Therapeuten
als konkordant wahrnehmen ließen.
Aus dieser therapeutischen Erfahrung heraus, begann
die Einführung der Hypnose in die bis dato ausschließlich (wenn auch modifizierte)
analytisch orientierte Therapie. Unter dem Eindruck der unmittelbaren Erfahrung
des Urlaubs begann die Patientin die einzelnen Szenen und Situationen in einem
Zustand mittlerer und z.T. tiefer Trance,- wobei sich die Induktion strikt
auf unmittelbares Körpererleben beschränkte,- nochmals zu durchleben. Gefühle
von Wohlbefinden, von Lust und Gehaltensein, aber auch von Wut und Niedergeschlagenheit,
von Alleinsein und Ohnmacht ließen sich mit den entsprechenden Körperwahrnehmungen
vergesellschaftet gut identifizieren und zum Teil als Analogie oder auch im
Gegensatz zum stattgehabten sinnlichen Erleben verbinden. In diesem Kontext
gelang es auch Analogien und Situationen aus anderen frühen Geschehnissen,
Erinnerungen und Erfahrungen, z.T. aus Filmen zu erinnern und verknüpfend
gefühlsmäßig plastisch werden zu lassen. Wie die über mehrere Sitzungen hinweg
verlaufende Nachbearbeitung dieser ersten kombinierten Stunde ergab, war es
der Patientin gelungen, eine bisher noch nie so bewusst erfahrene Gefühlstiefe
und Authentizität zu erleben, was ermutigte, in dieser Weise mit den Stunden
fortzufahren.
Im Laufe der weitere Behandlung (gesamt 160 Stunden bei mir und Fortführung
an einem anderen Wohnort) konnte dann im Rahmen mehrerer hypnotherapeutischer
Altersregressionen (Induktionen als unspezifische Geschichten über Schulzeit
und typische familiäre Situationen) eine sehr traumatische und für die Patientin
gefühlsmäßig sehr mitnehmende Kindheitsgeschichte tatsächlich bewusst erlebbar
werden, wobei es zunehmend gelang, ein affektives Bild- und Sprachinstrumentarium
zu entwickeln, dass es der Patientin ermöglichte,- jetzt weiter im vorwiegend
analytischen Prozess und - unter Freisetzung z.T. intensivster Wut - Haß-
und Racheempfindungen den erlittenen Kränkungen und Entwertungen vergleichsweise
angemessenen Ausdruck zu verleihen. In gleicher Weise gelang es aber auch
Freude, Begeisterung und intensive Glücksmomente- und Empfindungen zu verbalisieren,
wobei der Umstand, dass die Patientin Geige spielte und sich insgesamt sehr
für Musik interessierte, sehr hilfreiche Tranceinduktoren bzw. auch Gefühlskorrelate
boten. Es darf nicht verschwiegen werden, dass dieses "Gefühlelernen"
in Trance keineswegs mit den wenigen hier fokusartig geschilderten Stunden
erreicht war. Vielmehr zog sich dieser Prozess über die gesamte weiter Therapie
hin, wobei es zahlreiche Stunden gab, in denen es, - für beide Seiten recht
deprimierend,- den Anschein hatte, als würde gefühlsmäßiges Erleben und reale
Existenz im Prozess der Stunden losgelöst nebeneinander, wie abgeschnitten
und scheinbar isoliert existieren. Mit der intensiven und z.T. außerordentlich
schwierigen Bearbeitung dieses Spaltungserlebens, ebnete sich dann allerdings
ein immer dichter wahrnehmbarer Weg in eine gefühlsmäßige Autentizität.
Auf der realen Lebensebene waren diese Prozesse auch nicht ohne Folgen geblieben. So hatte die Patientin nach Überwindung eines sehr erheblichen inneren Widerstands den Versuch unternommen, mit der Mutter in einen Dialog über die gemeinsame Geschichte einzutreten, was allerdings von der Mutter infolge deren Persönlichkeit leider wenig produktiv ausfiel. Für die Patientin jedoch ergab sich aus diesen Gesprächen die Möglichkeit die Persönlichkeit der Mutter als gegeben und wohl nicht veränderbar zu akzeptieren und sich erstmalig ohne permanente Verpflichtungsgefühle ein Stück zu distanzieren. Es gelang auch ein nicht ausschließlich von der Mutter begrenztes Bild vom geschieden Vater zu entwickeln, was es in der Folgezeit ermöglichte, mit den Stiefgeschwistern Kontakt aufzunehmen und sich, im Gegensatz zu ihrer bisherigen Erfahrung, gefühlsmäßig als wichtiger Teil der Gesamtfamilie zu erfahren und daraus erneut einen Identitätsschub zu erleben.
Dieser kurze Ausschnitt aus einer Fallgeschichte mag verdeutlichen, dass es sich bei den üblichen psychotherapeutischen Methoden und insbesondere im Rahmen der Behandlung von psychosomatisch erkrankten Patienten (ähnliche Erfahrungen liegen dem Autor bei Patienten mit Rheuma, Migräne ,Asthma, Kolitis, Krebserkrankung und Schmerzsyndromen vor) durchaus lohnen mag, gezielt zum Instrumentarium der Ericksonschen Hypnose zu greifen, zumal die meisten psychotherapeutischen Methoden letztlich stets Beziehungstherapien sind, in denen es früher oder später um den oben postulierten gemeinsamen Dialog zu gehen hat. Ein gemeinsamer Dialog ist aber stets auch der Austausch von gemeinsamen Bildern und Erlebnissen, welche dann als besonders intensiv und gemeinsam erlebt werden, wenn sie in ihrer Bild- und Erlebnissprache kongruent sind, das heißt, wenn sich Absender und Empfänger zur gleichen Zeit im gleichen Gefühl wiederfinden. Wenn also beide sich in der Trance eines tiefen Beziehungserlebens befinden, wie Hypnotherapeuten einen solchen Vorgang bezeichnen würden. Quod erat demonstrandum.
Literatur beim Verfasser
Anschrift des Verfassers:
Dr. Hellmuth Schuckall
Psychotherapie/Psychoanalyse
Naturheilverfahren
Nördl. Auffahrtsallee 62
80638 München
E-Mail: drschuckall@Aol.com
Diese Informationen und Veranstaltungshinweise
finden Sie auch in der Zeitschrift Naturheilpraxis des Pflaum-Verlages: